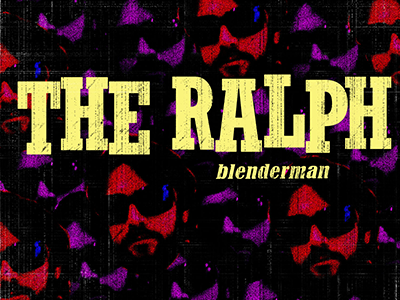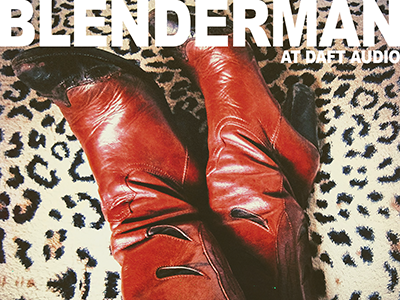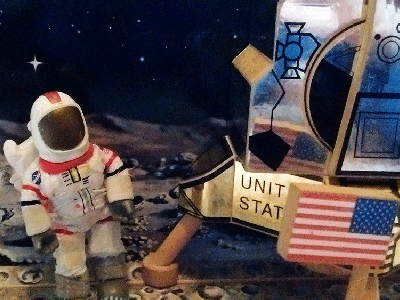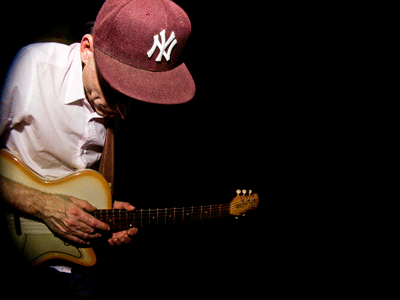Hesh on Ute Cohen – Glamour

Hesh on Ute Cohens neuestem Werk Glamour
Eine Kundin hängt das Cape wieder zurück auf den Ständer und murmelt: “Wann und wozu soll ich diese Jacke denn tragen?”
Von mir aus könnte die Dame das Teil auch für eine Latzhose halten. Es ist und bleibt ein kurzes Cape. Aus feinsten Damast-, Feincord- oder Samt-Stoffen gefertigt, verfügt es nur über zwei kleine Knöpfe, jeweils zur Linken und zur Rechten des Dekolleté.
Ich murmele: “Zugegeben, dieses, äh…, Kleidungsstück, ist das Gegenteil von praktisch. Man könnte sogar sagen, es ist vollkommen sinnlos. Andererseits ist es immerhin wunderschön. Weswegen Sie nochmal eine Größe kleiner probieren sollten…”
Ich arbeite in einem Bekleidungsgeschäft. Abgesehen von Petitessen, sage ich den Frauen, was ich denke. Das kommt in der Regel gut an – die Ladies haben ein Näschen dafür, wenn der nächste Kerl mit der nächsten Lüge daherkommt und ihnen sich selbst oder etwas anderes verkaufen will.
Die gute, alte, klassische Beratung ist ein spannendes Feld. Die Frauen, alle Frauen, sind hochkomplexe Kunstwerke; sie sind die Haute Couture unter den Menschenkindern. Nehmen Sie nur mal besagtes Dekolleté: Wie weit darf der Ausschnitt sein? (Sind gar erste kleine Fältchen am Schwanenhälschen zu sehen, welche es unbedingt zu bedecken gilt?) Oder der Oberarmbereich, zu dem jede einzelne Dame ihre ganz eigene Meinung hat, in den meisten Fällen eine äußerst kritische! Weiter geht’s, ebenso selbstverständlich wie – Gottlob! – unvermeidlich: Zum Po, dem Po und nochmals dem Po!
Keiner gleicht dem anderen. No, Sir.
Weil wir gerade in der Gegend sind…, ein und dieselbe Rocklänge kann die Beine einer Lady, vor allem in jenen ganz speziellen Bereichen sowohl über als auch unter dem Knie, regelrecht absägen oder aber, perfekt zur Geltung bringen. Nicht zu vergessen der Teint: Ein Kleid, dessen kräftige Farben die Eine erstrahlen lässt, lässt eine Andere in kränklicher Blässe versinken. Was hier sexy blinkt, kann da billig und aufgesetzt wirken.
Apropos billig und aufgesetzt: Die Sprache. Die Macht der Worte. Dass ich persönlich stämmige Ladies ebenso ansprechend finde, wie alle anderen Frauen – interessiert diverse Vollweiber einen Scheiß! Die Wörter stämmig oder gar propper, sind absolute No- Gos! Wie sehr es auch als Kompliment gemeint sein mag – die Damen hören: “Ich bin fett. Der Typ findet mich also fett! Ich bin … ich fühle mich fett! Was für ein taktloses Arschloch! Hier gehe ich nie, nie, nie wieder hin…!”
Das Zauberwort ist weiblich. Und gut.
All dies zwischen Kundin und Verkäufer zu thematisieren, ist heutzutage unüblich – weswegen das erfolgreiche Resultat einer ebenso sachbezogenen, ergebnisoffenen und bittschön empathischen Interaktion, die Frauen ein wenig glücklicher und unsere Fußgängerzonen partiell ein bisschen schöner machen kann.
Nun liegt es nahe anzunehmen, dass Stil, ein gutes Körpergefühl und die perfekte Kleiderwahl darin münden sollten, dass eine Person eine gewisse Klasse entwickelt. Und wenn jemand erst einmal Klasse hat, ist da nicht vielleicht auch die erste Stufe in Richtung Glamour erklommen?
Surprise, surprise: Trotz chronischen Geldmangels verfüge ich zufällig selbst über Klasse. Vom Aussehen her rangiere ich eher so unter medium ugly, wie tik tok-affine Dater-Innen raunen würden, aber was mein Gesamterscheinungsbild angeht, bin ich einer der bestangezogensten Männer, sagen wir mal, weltweit.
Aber Glamour?
In welchem Zusammenhang ist mir das Wort und dessen Bedeutung, oder gar eine seiner leibhaftigen Vertreterinnen, bisher überhaupt untergekommen?
Well …, wenn eine fremde Schöne mit ihren riesigen grün-glänzenden Scheinwerfern den Sichelmond über einer meiner einsamen Nächte fixiert und ihr lasziver Gang aus der Entfernung meine Hosenbeine ansengt, während ihre vor Herablassung knisternde Insolenz meine Augäpfel in glutheiße Backpflaumen verwandelt und ich beginne mich nach ihr zu verzehren, wie nach sonst nichts auf der Welt, dann neige ich gelegentlich dazu, diesem Wesen Glamourösität zu unterstellen.
Selbstredend imaginiere ich im Nachgang noch mindestens die Hälfte hinzu, entrüste mich, plustere mich auf, bis auf mindestens 1,77m… über die so unvergleichlich herausfordernde Grausamkeit, so dermaßen militant ignoriert zu werden!
Obwohl Madame doch lediglich keinerlei Notiz von mir genommen hat.
Vielleicht, aber nur vielleicht…, trägt mein kleinliches Bild vom glamourösen Vamp vs. Loser, ja tatsächlich einen Funken Wahrheit in sich. Und zwar – weil dieses fremde weibliche Wesen für mich absolut unerreichbar bleiben wird. Dito jede Form von Glamour.
Meine Welt ist frei von Glamour.
Sämtliche weiteren Assoziationen zum Thema gesellen sich aus der Peripherie hinzu, sprich, aus Filmen und Fieberträumen, in denen ich irgendwo in den Katakomben längst verfallener Kastelle nach meinen Wurzeln, wahlweise, meinem Selbstwertgefühl grabe, mich in Musik verliere und natürlich in der Vergangenheit, in welcher meine Romane im Kopf manchmal eben auch ein wenig Goldstaub, ein wenig Glamour auf mich herabrieseln lassen.
Tatsächlich habe ich keine Ahnung. Außer, dass ich es liebe, Dinge zu vermissen, die ich nie erlebt habe und mich nach Menschen sehne, die mir nie begegnet sind.
Im Gegensatz zu den erwähnten Fieberträumen kann ich meine Tagträume selbst gestalten: Da ist dann nix mit alten Kastellen oder gar frischen Ambitionen. Stattdessen sitze ich zusammen mit Fran und Estrella Damm im Außenbereich von Terminal One des El Prat zu Barca. Wir haben den Sommer von Blanes in den Knochen und noch vier Stunden Zeit, bis unser Flieger Richtung Jerez geht. Gegen Mitternacht werden wir in unserer Butze am Strand von Cadiz ankommen – und erstmal dableiben. Am nächsten Morgen diskutieren wir den Transport ihrer drei Industrienähmaschinen, Franny will unbedingt selbst fahren …
Das ist alles, wonach ich mich sehne.
Nun habe ich den purpur schimmernden – wir wollen es mal nicht übertreiben – ich meine natürlich, den schillernden, im abgedunkelten Horizont diverser intellektueller Einzeller und Volontariats-Amöben für ein glitzernd-raschelndes Feuerwerk aus bunten Nadelstichen, ach was, aus pinkfarbenen, mit Goldglitter bespränkelten Giftpfeilen sorgenden Essay von Ute Cohen gelesen.
Und, erwartungsgemäß, rein gar nichts verstanden.
Dafür habe ich jedes einzelne Wort gefühlt, wie mein Sohn Fred sagen würde. Ich habe mich über den Begriff der Sneaker-isierung von Berlin-Mitte amüsiert, einer Gegend, mit den am schlechtesten teuer gekleideten Menschen, deren Anblick zu verstoffwechseln ich mich je gezwungen sah. Zumindest, wenn man vom Besuch einer Show des Cirque du Soleil im Bellagio in Vegas absieht, wo man auf Steve Bannon-Typen mit Fußballfan-Wampen trifft, die da in kurzen Chinos und ausgebleichten Polos für zusammen so an die 1000 Bucks rumstehen – und sich jemanden, der sich selbst für glamourös hält, allerhöchstens auf höchst unappetitliche Weise kaufen könnten.
Für ein Stündchen, oder so.
Was hängen geblieben ist, abgesehen vom Vergnügen an Frau Cohens dichten sprachlichen Collagen – welche zu den Besten gehören, die ich von deutschsprachigen Schriftstellern in den letzten Jahren gelesen habe: Glamour scheint so etwas wie Punk Rock zu sein! Nur viel, viel älter – und nicht erst nach Dienstschluss in der Sparkassenfiliale. 24/7! Pure Anarchie! Wahre, absolute Freiheit! Das vielleicht letzte Aufbäumen dessen, wofür es sich lohnen würde, unglücklich verliebt zu sein oder zu früh abtreten zu müssen.
Ups.
Durchaus vorstellbar, dass dies von an die acht Milliarden Menschen auf Erden als ultimative Provokation angesehen werden kann. Und, laut Frau Cohen, von einer nicht unerheblichen Anzahl an Spaßbremsen auch wird. Weswegen sich das Phänomen des Glamour im Allgemeinen und dessen weibliche Vertreterinnen im besonderen erheblicher Kritik ausgesetzt sehen, offenbar durchaus auch mal aus… Berlin-Mitte! (Was sich, befürchte ich, so anfühlen muss, wie von verwelkten, antisemitischen MILFS zur Antisemitin gelabelt zu werden. Andererseits wissen die dann wenigstens einmal, wovon sie reden, während sie danebenliegen.)
Touché.
Das glamouröse Wesen seinerseits scheint so gar nicht auf der Suche nach sich selbst zu sein. Es hat sich längst gefunden und lässt lieber andere nach sich suchen. (Während der Lektüre von Glamour, in der Nahkampf-Zone der Dresdner Straßenbahnlinie No.7, fühlte ich mich gelegentlich an die – unter anderem von James Jones und Norman Mailer beschriebene – Anmut des Kriegers im Kampf erinnert. Und sei es auch nur, weil dieser das exakte Gegenteil darstellt.)
Denn das glamouröse Selbst-Verständnis hängt an nichts wirklich. Nicht einmal am Leben. Für das irdische Kasperle-Theater, für uns Aufziehmännel, in unseren Strampelanzügen und Business-Kostümchen, hat es noch nicht einmal Verachtung übrig!
Ruhig, Brauner.
Freizeit-Agitatoren mit Schaum vor dem Mund sind ja nun so gar nicht sexy. Geschweige denn, auch nur im Ansatz glamour-kompatibel. Damit bin ich allerdings nicht allein. Der/die/das GLAMOURÖSE inszeniert sich zwar ohne jeden Bezug zur Tagespolitik, aber dafür auf Teufel komm raus! Und das dermaßen lustvoll, dass jede lustlose Ideologin komplett alt aussieht.
Und ihrerseits Gift und Galle spuckt.
Aber auch für Wohlmeinende ist der wandelnde und, wie erwähnt, ganz besonders der graziös auf zwei endlos langen Beinen dahin wandelnde Glamour – uffz -, eine absolute Herausforderung. Sprich, ein erbarmungsloser Lackmustest, wie ein jeder von uns es denn tatsächlich hält, mit dem so verdammt einfach dahin gesagten, Leben und Leben lassen. Will sagen – das Interesse an identitätsstiftenden Illusionen wie Fairness und Chancengleichheit, ist in glamourösen Universen offenbar gleich null. Bildung, Vermögen und Weltgewandtheit müssen nicht allein vorhanden, nein, sie sollten bitteschön uralt sein.
Das glamouröse Momentum muss sich in nichts beweisen, seine pure Existenz ist Beweis an sich. Im Gegensatz dazu haftet allem, was Normalsterbliche mit viel Fleiß und Hingabe erreichen können, der Makel des Erarbeiteten, des Bemühten an. Damit sind sie allesamt raus aus dem Rennen. Ich selbst bin ein Arbeiterkind. Auch das bleibt man lebenslang – trotz Hütchen hier und Jackett-chen da.
Game over.
Wenn Sie also, ja Sie persönlich, mit meinem Interpretations-Mäandere nichts zu tun haben, aber dafür wissen wollen, ob es vom Anbeginn der Zeit einige wenige, wahrhaft außerirdisch-Unabhängige gibt auf Erden, was die so treiben und wie man sie erkennen kann – dann lesen Sie Glamour von Ute Cohen.
Ich bin sicher, Sie amüsieren sich köstlich!
Auch wenn besagte Lektüre letztendlich wohl ebenso sinnfrei ist, wie das eingangs erwähnte, wunderschöne, aber nutzlose Cape. Denn wirklich verstehen dürfte Frau Cohens glamourösen Essay wohl nur ein tatsächlich glamouröses Wesen. Nur würde es den Teufel tun, das Geheimnis zu lüften…
Heiko Hesh Schramm
Oktober 2025
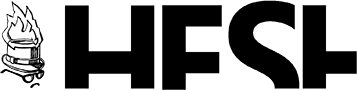
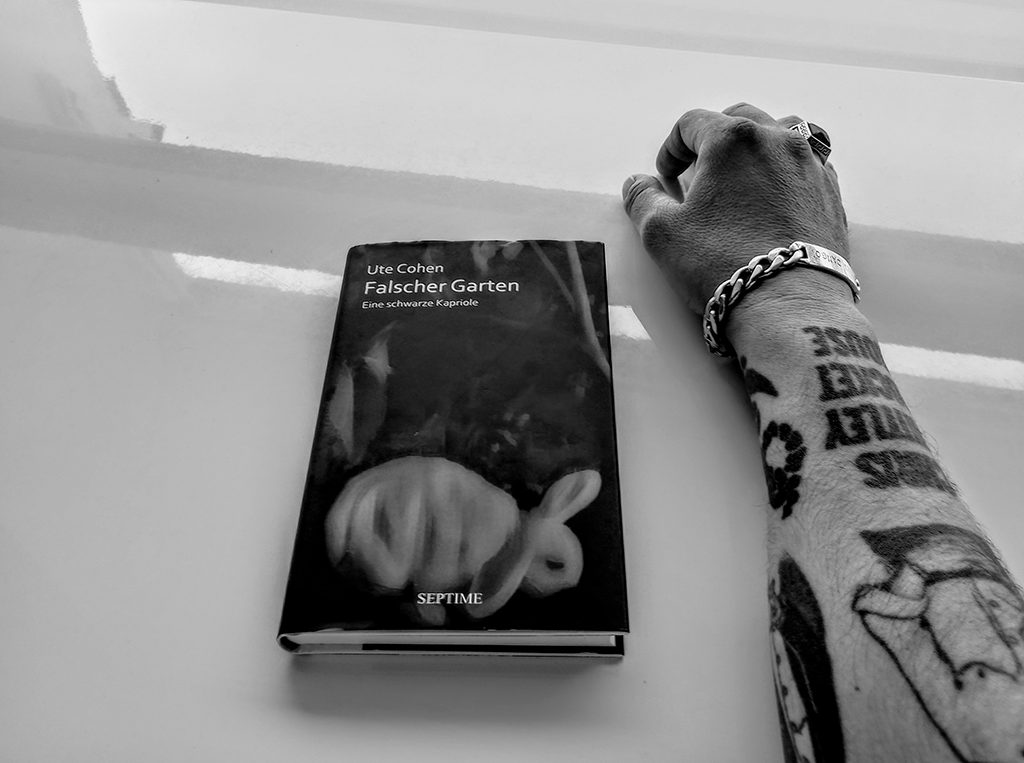
 “Ich werde eine reiche aktive Frau sein – nicht der Diener-Schatten, der ich war.”
Sylvia Plath
Heiko Hesh Schramm rezensiert POOR DOGS von Ute Cohen
Inside-Joke an den Septime Verlag, die Autorin und KBT: Top-Artwork 😉
“Poor Dogs”: Business Terminus. Bezieht sich auf die üblicherweise gängige Zusammensetzung eines Unternehmensportfolios. Als da wären: “Cash Cows”, “Stars”, “Question Marks” und, Vorhang auf: die sogenannten “Poor Dogs”. Letztere rangieren im Ranking ganz unten, da sie nur über einen relativ kleinen Marktanteil verfügen und kaum Marktwachstum generieren. Weswegen sich der Vorhang für sie als Erstes schließt, sprich, sie aus dem Depot rausfliegen, wenn der Wind frontal bläst.
Das Sujet des zweiten Romans von Ute Cohen ist knapp bemessen und wenig appetitlich, das Personal überschaubar und größtenteils widerlich. (Ein bisschen wie in “Ein plötzlicher Todesfall” von J.K. Rowling, nur im gehobeneren Preissegment.)
Alles beginnt mit Verrat, geht weiter mit Verrat und endet in einem Arrangement, welches sich nur mit dem Wort Totalkapitulation beschreiben lässt. Dazwischen Hauen und Stechen in der deutschen Niederlassung einer US-Unternehmensberatung, neoliberales Geschwätz aus der Externalisierungs-Matrix, gemeinsame Auslandsreisen von Mann und eventueller zukünftiger Erstfrau samt Sex und Croissants im Vorbeigehen, Solo-Dienstreisen desselben Herren samt Sex mit – ups – der blonden Dana; liebend gern auch mit einer Dritt- Viert-, oder Fünft-Frau, so es denn ein achthundert Seiten Roman geworden wäre und es sich zeitlich hätte einrichten lassen. Für irgendwas sind die Pussies immer gut, und sei es alle zusammen gegen die Kopfschmerzen. (Calm down. Alles nichts Ernstes. Sondern todernst: Besagte Type ist immer im Dienst, 24/7 wimmelt es nur so vor Poor Dogs in seinem Leben. Siehe auch: Die Kosten-Nutzen-Analyse als heiliger Gral derjenigen, denen rein gar nichts heilig ist: “Was bringt mir der oder die, und wann und wie sortiere ich den und den aus?!”
(John Malkovich in Gefährliche Liebschaften zur Visualisierung dieses Knilchs heranzuziehen, verbietet sich, leider. Die gottgegebene Klasse des Schauspielers schiebt einen Riegel vor. Ich für meinen Teil habe mich irgendwann für den jungen James Spader entschieden, und fürchte nun den Groll der Autorin.)
Was noch? Gemeinsame Besuche des Paares bei ihren Eltern auf dem Dorf (unerquicklich), den seinen in der Großstadt, (noch unerquicklicher), sowie die anschließende Heirat, (total unerquicklich – wenn auch die mit Abstand unterhaltsamste Passage im Text). Des Weiteren die Geburt eines Sohnes, welche bei den Mitgliedern der Familie auf ähnliche Begeisterung stößt wie die Fertigstellung des 10968873ten Fahrrads in Festlandchina, sowie ein Beinahe-Mord und ein Tatsächlicher. Irgendwann bügelt Frau die Hemden von Mann und Peiniger, und erwartet sehnsüchtig dessen Heimkehr.
André (Adam wäre zuviel der Ehre), der sephardische Jude.
Und Eva, die katholische Bayerin. Eva, unsere “arme Hündin.”
Eva inszeniert sich, indem sie sich selbst seziert. Als nehme sie einen chirurgischen Eingriff an sich vor. Oder beaufsichtige ihre eigene Ausweidung, am Tag der offenen Tür in der Pathologie: “Ruhig, Leute! Alle dürfen mal ran. Nur zu, Mädels, ich beiß doch nicht mehr!” Wenn wir uns da nur nicht zu früh gefreut haben. In den mit dem Skalpell freigelegten feinsten Verästelungen dessen, was Eva fühlt, denkt, und wie ein Schwamm aufsaugt, lauert die Hölle der Neuzeit. Die Gefühlte, Eingebildete, Tatsächliche. Das Mühen um das Stemmen von Eigenverantwortlichkeit, gepaart mit einem harten Wind da draußen im sozialen Miteinander. Die endlich heile Welt der Alten nach all dem Heil! vergangener Tage; jene Abgehärteten, Überlebenden, und noch endlos und drei Tage vor sich hin Lebenden, die sich nie die Mühe gemacht haben, die schwächliche, orientierungslose, vor sich hin mäandernde Brut ihrer Kinder entsprechend vorzubereiten: Wie bitte? Das Böse existiert einfach immer so weiter? Auch nach all den großen Kriegen? Erzähl doch nich’! Ihr wisst doch gar nicht, wie gut es Euch geht! Aus Euch wird nichts werden, schon allein deshalb, weil es heutzutage um rein gar nichts mehr geht! Aber nichts für ungut, meine Kleene! Hier, nimm noch ‘nen Schlag, ist auch noch Soße da.
Eva will weg vom Dorf, von Jugend und Vergangenheit, von all dem, was der Mensch hinnehmen muss, wenn er zu klein, und zu jung und zu abhängig ist, um einfach loszuziehen. Weg von der Mutter, deren Präsenz sich auf die Kontrolle ihrer Ausscheidungsorgane beschränkt, die den Laden zusammenhält, abzüglich der Banderole – längst mit allem was ihr je etwas bedeutet haben könnte, bewusst und im Vollbesitz ihrer geistigen oder besser letzten Kräfte abgeschlossen zu haben. Erst recht weg vom Vater, den Eva gleichwohl trotzig liebt, für seine Stoik bewundert, für eben jene Stoik hasst, bemitleidet und unterm Strich final für gescheitert hält, weil er seine Zeit, trotz allen Grolls einfach nur absitzt, anstatt nochmal anzugreifen, was die Frage aufwirft, wie tief sie sich da bitteschön einreihen soll?
Einfach weg und los, der Rest wird sich ergeben.
Manchmal ja, Meistens nicht. Der Vater sitzt tief. Väter mögen über ihre Töchter etwas über das Mysterium der Frauen lernen können, so sie das Herz dazu haben, die Töchter wiederum bekommen mittels ihrer Väter eine Vorschau frei Haus geliefert, bezüglich der Dramen, welche ihnen mit ihren Männern blühen. Damit lässt sich ein ordentlich schwerer Rucksack schnüren, vor allem wenn man bedenkt, dass man ihn niemals mehr wird abnehmen können. Mal sehen, was haben wir denn da: Zurückweisung, Falschheit, Aufbruchstimmung, verschwommene Bilder von einem guten Leben, für das man im wahrsten Sinne des Wortes jedes Bild stürmen, jede Parole nachbrüllen und einfach alles mit sich machen lassen würde. Hunger auf die Welt / sich paar in die Backen abholen / Ekel vor der Welt. Immer wieder zurückschnipsend auf Null.
Was will die eigentlich? Worum geht es ihr, gottverdammt nochmal?!
“Ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn… Mein Gott, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn …”
… hin? Dunno.
Das Problem: Das Buch spielt nicht in den 60ern, zu Mad Men Zeiten. (Wir erinnern uns: Werbeagentur, Manhattan, Frauen und Männer gut gekleidet – I know, heutzutage vollkommen unvorstellbar – und dann schert da doch so ein kleines hässliches Entlein aus und will den Platzhirschen ein Stückchen ihres angestammten Platzes ab-huschen?) Nein, Poor Dogs ist späte Neunziger, ein paar Jährchen bevor die New Yorker-Innen (die damals – inklusive aller Minderheiten – noch New Yorker hießen) über Nacht Schlange standen fürs erste iPhone, aber nicht lange genug her, als dass man sich großartig in Sicherheit wiegen könnte, was den Zustand der beruflichen Chancengleichheit von Frauen in diesem Land angeht. Nich’ viel gewor’n mit der Mutter Born …
Evas Figur, ihr Agieren, bzw. Nicht-Agieren – ist eine Provokation.
Für die Männer, die sich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass der Weg, an dessen Ende Übergriff, Vergewaltigung und Mord stehen, mit der ersten, fetten Lüge beginnt.
Und für all jene Frauen, die einfach mal alles wollen, ohne eine Ahnung zu haben, wovon sie überhaupt reden. Die ihre Opferrolle, welche nun weiß Gott und zur Ehrenrettung nicht allein auf ihrem Mist gewachsen ist, kultivieren, um in deren Schatten mit der Skrupellosigkeit “der Männer” zu konkurrieren.
Beruf und Familie, schafft ein Paar selbst mit der besten staatlichen Kinderbetreuung nur zusammen. Mit wolfshündisch-angehauchten Angstbeißern wie André, ist das schlicht unmöglich. Und Eva ist nun mal so wenig dumm und naiv, wie auf der anderen Seite in höchstem Maße ambitioniert.
Haifisch oder Mutti? Das könnte hier die Frage sein.
Oder, mit aller Kulanz sowie als Ode an Evas gigantisches Rechenzentrum hinter ihrer schönen Stirn: Warum er?
“Und der Haifisch, der hat Zähne – und die trägt er im Gesicht
und Macheath, der hat ein Messer – doch das Messer sieht man nicht.”
Bertolt Brecht
Touché. Irgendwann fühlt sich in diesem Buch jeder und jede dem jeweils anderen überlegen, den Leser eingeschlossen. Ein Arschloch haben alle bis heute bekannten Geschlechter, die Frage ist, warum reißen sich die Leute nur so darum, unbedingt auch eins sein zu wollen?
Ähnlich wie Michel Houellebecq in Unterwerfung, der eine Dystopie entwirft, welche einen Schatten aus der Zukunft auf die Gegenwart wirft, lädt auch Ute Cohen den Leser dazu ein, nach dem Ende des Buches gedanklich in die Verlängerung zu gehen. Nur dass die Chose hier über konsequente Auslassung läuft: Auslassung all dessen, was, in meinen Augen, das Leben lebenswert macht. Die Abwesenheit von etwas, die Leerstelle, lässt mich den Verlust spüren. Liebe, alle gesund, heißes Wasser aus’m Hahn. Ein Kassensturz in eigener Sache, die Konsequenz aus der Extra-Time: Tust du irgendwas, was dir nicht gut tut? Ist der Preis für etwas, was du unbedingt willst, letztendlich zu hoch? Bist du von Leuten umgeben, mit denen du nicht auch einen Trinken gehen würdest? (Thanks, Bob Mitchum!)
Der Cohen’sche Kunstgriff: Auch innerhalb des Buches, existiert diese Ebene. Nur ohne Kassensturz: Eva spürt alles. Jede einzelne Lüge, Erniedrigung, von Respekt nicht zu reden, denn der bleibt ihr versagt. Die Ergebnisse ihrer turbo-empathischen, nur krankhaft waidwund zu nennenden Permanent-Analysen ein aufs andere Mal kläglich versanden zu lassen, anstatt sich zu verhalten, zu positionieren, sprich, die ganze Bagage endlich zum Teufel zu jagen, grenzt an Übergriffigkeit sich selbst gegenüber. Weswegen sie krank wird, im Grau-Grau von Tscheljabinsk, Russland, eine Parasitose entwickelt, in Düsseldorf im Hospital landet und anstatt in der Perlung eißgekühlten Champagners, im Kaffeesatz eines randvollen Eimers mit eitrigen Exkrementen nach der Wahrheit suchen muss. Ich zitiere:
“Sie fühlte das Verlangen, den Finger in den Schleim hineinzutauchen, hinab bis auf den Grund, den sie klar und kühl erhoffte. Bakterien würden sich um ihre Finger scharen, sie umzingeln, die Fingerkuppen erklimmen und an den Nägeln empor recken, um ihr die Nachricht entgegen zu schreien: Bald ist es vorbei!”
So grauenhaft es sich für Eva anfühlen mag, so unerträglich morbide sich diese Seiten lesen – für die deutsche Gegenwartsliteratur und ihren recht schmalen Kanon an spektakulären Bildern ist es ein Glücksfall, dass Ute Cohen sich wie keine Zweite ekeln kann. (Für den Leser, welcher Eva im Buch pausenlos scheinbar unendlich nahe kommt, nur um zu erleben, dass Madame niemanden, nicht einmal sich selbst, jemals wirklich an sich heranlässt, geradezu eine Offenbarung! Miau / wahlweise Wuff!)
And here we are again, wolfs-höllisch Cohen-ish:
“Die Flüssigkeit roch nach Fäulnis, nicht schweflig wie ein schlecht verdautes Ei, auch nicht bitter nach vergorenen Speiseresten. Es war ein süßlicher Geruch, ein Duft nach Verderbnis und doch verlockend. Abgestandene, bald geronnene Milch, die, noch geschützt von einer Haut aus Zeichen, stagnierte in diesem Gefäß, bald jedoch in der Kanalisation landete, hinabgespült und gereinigt würde und schließlich wieder durch den Wasserhahn flösse und durch ihre Kehle rönne.”
Das Ziehen einer Parallele von Verwesung und zellulärem Zerfall, mit dem Implodieren der Grundregeln ethischen, zivilisierten Verhaltens in der westlichen Gesellschaft lässt den Agnostiker in mir, sich dem Atheisten für diese Runde geschlagen geben.
Das will ich! Von einem Song, einem Bild, Foto, Text, von der Liebe, von Freund und Feind, oder, wie in diesem Fall, einem Roman: Dass ich es kaum aushalte. Es liebe, hasse, und noch mehr hasse, weil es alles über den Haufen wirft, was bisher sicher schien. Das fucking Gegenteil von Zeitverschwendung. So degoutant Poor Dogs bisweilen daherkommt, niemand kann sich herausreden. Oder um, ohne jede Bescheidenheit, das meiner Arbeit zugrunde liegende Credo zu bemühen: Alles was der Mensch tut, ist per se menschlich.
Die menschliche Wehmut, übersetzt, sich an das eigene bisschen Leben zu klammern; hat viele Gesichter. Ich musste beim Lesen von Poor Dogs oft an Montauk von Max Frisch denken. Affentänze hin oder her – alles geht, nichts kannst du festhalten. Der große, alte, weiße Mann wusste das, den Protagonisten in Poor Dogs wird selbige Erkenntnis nicht erspart bleiben.
Das vorliegende Werk ist geprägt vom Vierklang sprachlicher Perfektion: Präzision, Effizienz, Opulenz und Relevanz. Der Duktus kennt keinerlei Erbarmen. Was daran liegt, dass Frau Cohen, wie jede psychisch halbwegs stabile Frau, mit derlei Begrifflichkeiten nichts anfangen kann. Weil sie nah am Puls einer Welt auf der Lauer liegt, welche sich erbarmungslos immer nur um sich selber dreht. Es sei denn, wir entscheiden eines Tages anders, und reden wieder mehr mit- statt übereinander.
The Army of Hesh
“Ich werde eine reiche aktive Frau sein – nicht der Diener-Schatten, der ich war.”
Sylvia Plath
Heiko Hesh Schramm rezensiert POOR DOGS von Ute Cohen
Inside-Joke an den Septime Verlag, die Autorin und KBT: Top-Artwork 😉
“Poor Dogs”: Business Terminus. Bezieht sich auf die üblicherweise gängige Zusammensetzung eines Unternehmensportfolios. Als da wären: “Cash Cows”, “Stars”, “Question Marks” und, Vorhang auf: die sogenannten “Poor Dogs”. Letztere rangieren im Ranking ganz unten, da sie nur über einen relativ kleinen Marktanteil verfügen und kaum Marktwachstum generieren. Weswegen sich der Vorhang für sie als Erstes schließt, sprich, sie aus dem Depot rausfliegen, wenn der Wind frontal bläst.
Das Sujet des zweiten Romans von Ute Cohen ist knapp bemessen und wenig appetitlich, das Personal überschaubar und größtenteils widerlich. (Ein bisschen wie in “Ein plötzlicher Todesfall” von J.K. Rowling, nur im gehobeneren Preissegment.)
Alles beginnt mit Verrat, geht weiter mit Verrat und endet in einem Arrangement, welches sich nur mit dem Wort Totalkapitulation beschreiben lässt. Dazwischen Hauen und Stechen in der deutschen Niederlassung einer US-Unternehmensberatung, neoliberales Geschwätz aus der Externalisierungs-Matrix, gemeinsame Auslandsreisen von Mann und eventueller zukünftiger Erstfrau samt Sex und Croissants im Vorbeigehen, Solo-Dienstreisen desselben Herren samt Sex mit – ups – der blonden Dana; liebend gern auch mit einer Dritt- Viert-, oder Fünft-Frau, so es denn ein achthundert Seiten Roman geworden wäre und es sich zeitlich hätte einrichten lassen. Für irgendwas sind die Pussies immer gut, und sei es alle zusammen gegen die Kopfschmerzen. (Calm down. Alles nichts Ernstes. Sondern todernst: Besagte Type ist immer im Dienst, 24/7 wimmelt es nur so vor Poor Dogs in seinem Leben. Siehe auch: Die Kosten-Nutzen-Analyse als heiliger Gral derjenigen, denen rein gar nichts heilig ist: “Was bringt mir der oder die, und wann und wie sortiere ich den und den aus?!”
(John Malkovich in Gefährliche Liebschaften zur Visualisierung dieses Knilchs heranzuziehen, verbietet sich, leider. Die gottgegebene Klasse des Schauspielers schiebt einen Riegel vor. Ich für meinen Teil habe mich irgendwann für den jungen James Spader entschieden, und fürchte nun den Groll der Autorin.)
Was noch? Gemeinsame Besuche des Paares bei ihren Eltern auf dem Dorf (unerquicklich), den seinen in der Großstadt, (noch unerquicklicher), sowie die anschließende Heirat, (total unerquicklich – wenn auch die mit Abstand unterhaltsamste Passage im Text). Des Weiteren die Geburt eines Sohnes, welche bei den Mitgliedern der Familie auf ähnliche Begeisterung stößt wie die Fertigstellung des 10968873ten Fahrrads in Festlandchina, sowie ein Beinahe-Mord und ein Tatsächlicher. Irgendwann bügelt Frau die Hemden von Mann und Peiniger, und erwartet sehnsüchtig dessen Heimkehr.
André (Adam wäre zuviel der Ehre), der sephardische Jude.
Und Eva, die katholische Bayerin. Eva, unsere “arme Hündin.”
Eva inszeniert sich, indem sie sich selbst seziert. Als nehme sie einen chirurgischen Eingriff an sich vor. Oder beaufsichtige ihre eigene Ausweidung, am Tag der offenen Tür in der Pathologie: “Ruhig, Leute! Alle dürfen mal ran. Nur zu, Mädels, ich beiß doch nicht mehr!” Wenn wir uns da nur nicht zu früh gefreut haben. In den mit dem Skalpell freigelegten feinsten Verästelungen dessen, was Eva fühlt, denkt, und wie ein Schwamm aufsaugt, lauert die Hölle der Neuzeit. Die Gefühlte, Eingebildete, Tatsächliche. Das Mühen um das Stemmen von Eigenverantwortlichkeit, gepaart mit einem harten Wind da draußen im sozialen Miteinander. Die endlich heile Welt der Alten nach all dem Heil! vergangener Tage; jene Abgehärteten, Überlebenden, und noch endlos und drei Tage vor sich hin Lebenden, die sich nie die Mühe gemacht haben, die schwächliche, orientierungslose, vor sich hin mäandernde Brut ihrer Kinder entsprechend vorzubereiten: Wie bitte? Das Böse existiert einfach immer so weiter? Auch nach all den großen Kriegen? Erzähl doch nich’! Ihr wisst doch gar nicht, wie gut es Euch geht! Aus Euch wird nichts werden, schon allein deshalb, weil es heutzutage um rein gar nichts mehr geht! Aber nichts für ungut, meine Kleene! Hier, nimm noch ‘nen Schlag, ist auch noch Soße da.
Eva will weg vom Dorf, von Jugend und Vergangenheit, von all dem, was der Mensch hinnehmen muss, wenn er zu klein, und zu jung und zu abhängig ist, um einfach loszuziehen. Weg von der Mutter, deren Präsenz sich auf die Kontrolle ihrer Ausscheidungsorgane beschränkt, die den Laden zusammenhält, abzüglich der Banderole – längst mit allem was ihr je etwas bedeutet haben könnte, bewusst und im Vollbesitz ihrer geistigen oder besser letzten Kräfte abgeschlossen zu haben. Erst recht weg vom Vater, den Eva gleichwohl trotzig liebt, für seine Stoik bewundert, für eben jene Stoik hasst, bemitleidet und unterm Strich final für gescheitert hält, weil er seine Zeit, trotz allen Grolls einfach nur absitzt, anstatt nochmal anzugreifen, was die Frage aufwirft, wie tief sie sich da bitteschön einreihen soll?
Einfach weg und los, der Rest wird sich ergeben.
Manchmal ja, Meistens nicht. Der Vater sitzt tief. Väter mögen über ihre Töchter etwas über das Mysterium der Frauen lernen können, so sie das Herz dazu haben, die Töchter wiederum bekommen mittels ihrer Väter eine Vorschau frei Haus geliefert, bezüglich der Dramen, welche ihnen mit ihren Männern blühen. Damit lässt sich ein ordentlich schwerer Rucksack schnüren, vor allem wenn man bedenkt, dass man ihn niemals mehr wird abnehmen können. Mal sehen, was haben wir denn da: Zurückweisung, Falschheit, Aufbruchstimmung, verschwommene Bilder von einem guten Leben, für das man im wahrsten Sinne des Wortes jedes Bild stürmen, jede Parole nachbrüllen und einfach alles mit sich machen lassen würde. Hunger auf die Welt / sich paar in die Backen abholen / Ekel vor der Welt. Immer wieder zurückschnipsend auf Null.
Was will die eigentlich? Worum geht es ihr, gottverdammt nochmal?!
“Ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn… Mein Gott, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn …”
… hin? Dunno.
Das Problem: Das Buch spielt nicht in den 60ern, zu Mad Men Zeiten. (Wir erinnern uns: Werbeagentur, Manhattan, Frauen und Männer gut gekleidet – I know, heutzutage vollkommen unvorstellbar – und dann schert da doch so ein kleines hässliches Entlein aus und will den Platzhirschen ein Stückchen ihres angestammten Platzes ab-huschen?) Nein, Poor Dogs ist späte Neunziger, ein paar Jährchen bevor die New Yorker-Innen (die damals – inklusive aller Minderheiten – noch New Yorker hießen) über Nacht Schlange standen fürs erste iPhone, aber nicht lange genug her, als dass man sich großartig in Sicherheit wiegen könnte, was den Zustand der beruflichen Chancengleichheit von Frauen in diesem Land angeht. Nich’ viel gewor’n mit der Mutter Born …
Evas Figur, ihr Agieren, bzw. Nicht-Agieren – ist eine Provokation.
Für die Männer, die sich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass der Weg, an dessen Ende Übergriff, Vergewaltigung und Mord stehen, mit der ersten, fetten Lüge beginnt.
Und für all jene Frauen, die einfach mal alles wollen, ohne eine Ahnung zu haben, wovon sie überhaupt reden. Die ihre Opferrolle, welche nun weiß Gott und zur Ehrenrettung nicht allein auf ihrem Mist gewachsen ist, kultivieren, um in deren Schatten mit der Skrupellosigkeit “der Männer” zu konkurrieren.
Beruf und Familie, schafft ein Paar selbst mit der besten staatlichen Kinderbetreuung nur zusammen. Mit wolfshündisch-angehauchten Angstbeißern wie André, ist das schlicht unmöglich. Und Eva ist nun mal so wenig dumm und naiv, wie auf der anderen Seite in höchstem Maße ambitioniert.
Haifisch oder Mutti? Das könnte hier die Frage sein.
Oder, mit aller Kulanz sowie als Ode an Evas gigantisches Rechenzentrum hinter ihrer schönen Stirn: Warum er?
“Und der Haifisch, der hat Zähne – und die trägt er im Gesicht
und Macheath, der hat ein Messer – doch das Messer sieht man nicht.”
Bertolt Brecht
Touché. Irgendwann fühlt sich in diesem Buch jeder und jede dem jeweils anderen überlegen, den Leser eingeschlossen. Ein Arschloch haben alle bis heute bekannten Geschlechter, die Frage ist, warum reißen sich die Leute nur so darum, unbedingt auch eins sein zu wollen?
Ähnlich wie Michel Houellebecq in Unterwerfung, der eine Dystopie entwirft, welche einen Schatten aus der Zukunft auf die Gegenwart wirft, lädt auch Ute Cohen den Leser dazu ein, nach dem Ende des Buches gedanklich in die Verlängerung zu gehen. Nur dass die Chose hier über konsequente Auslassung läuft: Auslassung all dessen, was, in meinen Augen, das Leben lebenswert macht. Die Abwesenheit von etwas, die Leerstelle, lässt mich den Verlust spüren. Liebe, alle gesund, heißes Wasser aus’m Hahn. Ein Kassensturz in eigener Sache, die Konsequenz aus der Extra-Time: Tust du irgendwas, was dir nicht gut tut? Ist der Preis für etwas, was du unbedingt willst, letztendlich zu hoch? Bist du von Leuten umgeben, mit denen du nicht auch einen Trinken gehen würdest? (Thanks, Bob Mitchum!)
Der Cohen’sche Kunstgriff: Auch innerhalb des Buches, existiert diese Ebene. Nur ohne Kassensturz: Eva spürt alles. Jede einzelne Lüge, Erniedrigung, von Respekt nicht zu reden, denn der bleibt ihr versagt. Die Ergebnisse ihrer turbo-empathischen, nur krankhaft waidwund zu nennenden Permanent-Analysen ein aufs andere Mal kläglich versanden zu lassen, anstatt sich zu verhalten, zu positionieren, sprich, die ganze Bagage endlich zum Teufel zu jagen, grenzt an Übergriffigkeit sich selbst gegenüber. Weswegen sie krank wird, im Grau-Grau von Tscheljabinsk, Russland, eine Parasitose entwickelt, in Düsseldorf im Hospital landet und anstatt in der Perlung eißgekühlten Champagners, im Kaffeesatz eines randvollen Eimers mit eitrigen Exkrementen nach der Wahrheit suchen muss. Ich zitiere:
“Sie fühlte das Verlangen, den Finger in den Schleim hineinzutauchen, hinab bis auf den Grund, den sie klar und kühl erhoffte. Bakterien würden sich um ihre Finger scharen, sie umzingeln, die Fingerkuppen erklimmen und an den Nägeln empor recken, um ihr die Nachricht entgegen zu schreien: Bald ist es vorbei!”
So grauenhaft es sich für Eva anfühlen mag, so unerträglich morbide sich diese Seiten lesen – für die deutsche Gegenwartsliteratur und ihren recht schmalen Kanon an spektakulären Bildern ist es ein Glücksfall, dass Ute Cohen sich wie keine Zweite ekeln kann. (Für den Leser, welcher Eva im Buch pausenlos scheinbar unendlich nahe kommt, nur um zu erleben, dass Madame niemanden, nicht einmal sich selbst, jemals wirklich an sich heranlässt, geradezu eine Offenbarung! Miau / wahlweise Wuff!)
And here we are again, wolfs-höllisch Cohen-ish:
“Die Flüssigkeit roch nach Fäulnis, nicht schweflig wie ein schlecht verdautes Ei, auch nicht bitter nach vergorenen Speiseresten. Es war ein süßlicher Geruch, ein Duft nach Verderbnis und doch verlockend. Abgestandene, bald geronnene Milch, die, noch geschützt von einer Haut aus Zeichen, stagnierte in diesem Gefäß, bald jedoch in der Kanalisation landete, hinabgespült und gereinigt würde und schließlich wieder durch den Wasserhahn flösse und durch ihre Kehle rönne.”
Das Ziehen einer Parallele von Verwesung und zellulärem Zerfall, mit dem Implodieren der Grundregeln ethischen, zivilisierten Verhaltens in der westlichen Gesellschaft lässt den Agnostiker in mir, sich dem Atheisten für diese Runde geschlagen geben.
Das will ich! Von einem Song, einem Bild, Foto, Text, von der Liebe, von Freund und Feind, oder, wie in diesem Fall, einem Roman: Dass ich es kaum aushalte. Es liebe, hasse, und noch mehr hasse, weil es alles über den Haufen wirft, was bisher sicher schien. Das fucking Gegenteil von Zeitverschwendung. So degoutant Poor Dogs bisweilen daherkommt, niemand kann sich herausreden. Oder um, ohne jede Bescheidenheit, das meiner Arbeit zugrunde liegende Credo zu bemühen: Alles was der Mensch tut, ist per se menschlich.
Die menschliche Wehmut, übersetzt, sich an das eigene bisschen Leben zu klammern; hat viele Gesichter. Ich musste beim Lesen von Poor Dogs oft an Montauk von Max Frisch denken. Affentänze hin oder her – alles geht, nichts kannst du festhalten. Der große, alte, weiße Mann wusste das, den Protagonisten in Poor Dogs wird selbige Erkenntnis nicht erspart bleiben.
Das vorliegende Werk ist geprägt vom Vierklang sprachlicher Perfektion: Präzision, Effizienz, Opulenz und Relevanz. Der Duktus kennt keinerlei Erbarmen. Was daran liegt, dass Frau Cohen, wie jede psychisch halbwegs stabile Frau, mit derlei Begrifflichkeiten nichts anfangen kann. Weil sie nah am Puls einer Welt auf der Lauer liegt, welche sich erbarmungslos immer nur um sich selber dreht. Es sei denn, wir entscheiden eines Tages anders, und reden wieder mehr mit- statt übereinander.
The Army of Hesh

 Auszug aus Heiko Hesh Schramms Roman Die große Plauderei – Buch 3, erschienen auf
Auszug aus Heiko Hesh Schramms Roman Die große Plauderei – Buch 3, erschienen auf